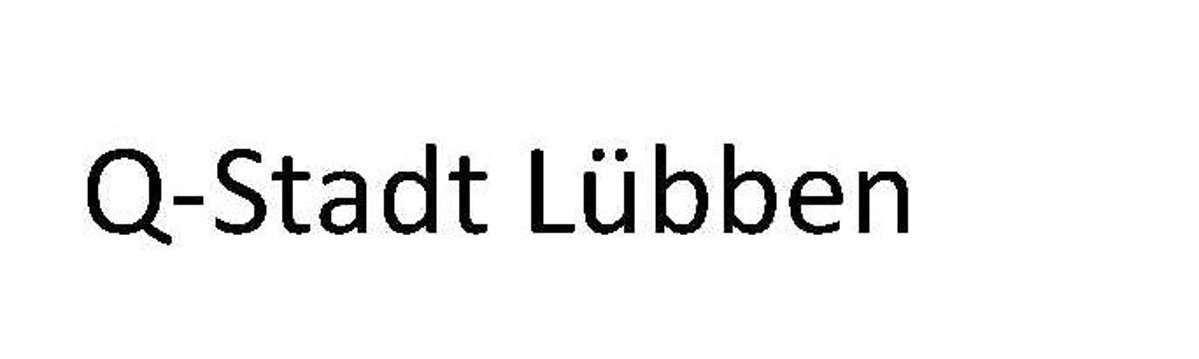Bereits im Juni haben wir über die aktuellen finanziellen Herausforderungen der Stadt Lübben (Spreewald) berichtet. Nun wird deutlich: Die kommenden Monate verlangen schwierige Entscheidungen, die sowohl die Verwaltung als auch die Bürgerschaft unmittelbar betreffen. Bürgermeister Jens Richter ist es ein Anliegen, die Menschen in Lübben frühzeitig mitzunehmen, offen zu informieren und Erwartungen transparent mit den tatsächlichen Handlungsspielräumen abzugleichen. Dabei geht es um nichts weniger als die Zukunftsfähigkeit der Stadt: Wie lassen sich die finanziellen Grundlagen sichern, ohne die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger unnötig einzuschränken?
Im folgenden Gespräch schildert Bürgermeister Jens Richter, wie er die aktuelle Lage einschätzt, wo er Chancen und Grenzen sieht – und welche Schritte nun anstehen.
Herr Bürgermeister, die Haushaltslage der Stadt Lübben wird in der Öffentlichkeit zunehmend als angespannt wahrgenommen. Wie würden Sie die aktuelle Situation beschreiben?
Die Einschätzung ist leider zutreffend. Wir stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Die steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen belasten unseren städtischen Haushalt stark. Gleichzeitig stagnieren oder sinken die Einnahmen, insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich oder der Gewerbesteuer.
Wie reagieren die Bürgerinnen und Bürger auf diese Entwicklungen?
Viele zeigen Verständnis, aber natürlich gibt es auch Kritik. Das ist nachvollziehbar. Wir versuchen, transparent zu kommunizieren und die Menschen mitzunehmen. Die Haushaltslage betrifft uns alle – und nur gemeinsam können wir Lösungen finden.
Ein wesentlicher Kostenfaktor, der vielerorts für Druck sorgt, sind die Personalausgaben. Wie stellt sich die Lage in Lübben dar?
Die Personalkosten sind tatsächlich ein zentraler Punkt. In fast allen Kommunen haben sie sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt – das bestätigt auch der aktuelle Kommunale Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung. Bei uns in Lübben ist das nicht unbedingt auf einen übermäßigen Stellenaufbau zurückzuführen. Im Gegenteil: Wir haben keine gravierend neuen Stellen geschaffen, sondern sind mit einem jungen, leistungsfähigen Team unterwegs. Altersbedingtes Ausscheiden ist bei uns nur begrenzt absehbar – das heißt, klassische Einsparpotenziale durch Pensionierungen sind kaum vorhanden. Den demografischen Wandel haben wir frühzeitig und erfolgreich gemeistert, was uns von vielen anderen Kommunen unterscheidet. Trotzdem gilt: Jede freiwerdende Stelle wird kritisch hinterfragt. Wir müssen effizient bleiben, ohne die Qualität unserer Leistungen zu gefährden.
Die finanzielle Schieflage betrifft nicht nur Lübben – bundesweit melden Kommunen Defizite. Wie bewerten Sie die übergeordnete Entwicklung?
Die Lage ist tatsächlich alarmierend. Laut dem aktuellen Kommunalfinanzreport der Bertelsmann Stiftung liegt das Defizit aller deutschen Kommunen bei rund 25 Milliarden Euro – das größte in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Ursachen sind vielfältig: hohe Inflation, stagnierende Einnahmen, wachsende Sozialausgaben und gesetzliche Vorgaben ohne ausreichende Gegenfinanzierung. Was uns besonders Sorge bereitet, ist die Situation in Städten und Gemeinden im Landkreis Dahme-Spreewald, die ebenfalls unter massivem Druck stehen. Das wirkt sich über die Kreisumlage direkt auf uns aus und verschärft die Lage zusätzlich. Aus meiner Sicht stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung – die Prognosen zeigen, dass sich das strukturelle Defizit in den kommenden Jahren sogar noch ausweiten könnte.
Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, was „Sparen" konkret bedeutet. Können Sie das näher erläutern?
Ja, das ist mir ein zentrales Anliegen. Wenn wir über Einsparungen sprechen, müssen wir klar zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen unterscheiden. Alles, was gesetzlich oder durch Satzung geregelt ist – etwa die Abwasserentsorgung, die Schulentwicklungsplanung oder die Ordnungsverwaltung – müssen wir erfüllen. Diese Aufgaben sind nicht verhandelbar. Bei den freiwilligen Leistungen, wie etwa Kulturangebote, Sportförderung oder Freizeitprojekte müssen wir prüfen, welchen Spielraum wir haben.
Aber Sparen bedeutet für mich nicht einfach „Streichen". Es geht vielmehr darum, ob Leistungen auch anders erbracht werden können – effizienter, partnerschaftlich oder digital. Ich wünsche mir, dass unsere Verwaltung weiterhin sorgsam, sparsam und wirtschaftlich agiert. Das heißt: Wir hinterfragen selbstverständlich jede Ausgabe, jede Struktur, und suchen nach intelligenten Lösungen, ohne die Lebensqualität in Lübben leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
Sie haben mehrfach betont, dass strukturelle Reformen notwendig sind. Welche Alternativen sehen Sie?
Ich halte es für dringend geboten, die Vielzahl an Förderprogrammen in Deutschland zu überprüfen. Die Idee, Kommunen über projektbezogene Fördermittel zu unterstützen, klingt zunächst sinnvoll – in der Praxis ist sie jedoch oft bürokratisch, zeitaufwendig und ineffizient. Die Suche nach passenden Programmen, die Antragstellung und die Nachweispflichten binden enorme personelle Ressourcen. Ich wünsche mir ein Umdenken auf allen Ebenen: Statt komplizierter Förderlogik sollten Kommunen direkt und pauschal finanziell gestärkt werden. Denn wir vor Ort wissen am besten, welche Probleme bestehen und wie sie gelöst werden können.
Ein weiterer Punkt ist die ungleiche Verteilung der Steuereinnahmen. Laut dem Deutschen Städtetag sind die Kommunen für rund 25 Prozent aller öffentlichen Aufgaben verantwortlich – erhalten aber nur etwa 15 Prozent der Steuereinnahmen. Das passt nicht zusammen. Wir übernehmen zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge, von Bildung über Infrastruktur bis hin zur Gesundheit – aber die Finanzierung ist nicht auskömmlich. Wenn wir langfristig handlungsfähig bleiben wollen, brauchen wir eine faire und aufgabengerechte Steuerverteilung sowie mehr Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung.
Der Bund stellt den Kommunen derzeit zusätzliche Investitionsmittel zur Verfügung. Können diese die Lage in Lübben spürbar verbessern?
Sie helfen – aber nur bedingt. Jede neue Investition bedeutet nicht nur eine einmalige Ausgabe, sondern zieht Folgekosten nach sich: Abschreibungen, laufende Unterhaltung, Instandhaltung und oft auch personelle Ressourcen. Das wird häufig unterschätzt. Wir prüfen aktuell sehr genau, welchen Spielraum uns die zusätzlichen Mittel tatsächlich eröffnen. Es geht nicht darum, möglichst viel zu bauen – sondern darum, verantwortungsvoll zu investieren. Wir müssen sicherstellen, dass wir auch in zehn oder zwanzig Jahren noch in der Lage sind, diese Infrastruktur zu erhalten.
Der Kämmerer hat im September Haushaltssperren für einige Haushaltspositionen erteilt. Welche speziellen Auswirkungen hat die Maßnahme?
Die vom Kämmerer verfügte Haushaltssperre ist ein haushaltsrechtliches Instrument, um den Haushaltsausgleich sicherzustellen und die Zahlungsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten. Konkret bedeutet dies, dass bestimmte Ausgaben bis auf Weiteres nicht oder nur eingeschränkt getätigt werden dürfen. Betroffen sind vor allem freiwillige Leistungen, beispielsweise die Repräsentationskosten des Bürgermeisters sowie freiwillige Mittel für Vereine und Kulturschaffende. Darüber hinaus wurden einzelne investive Maßnahmen zurückgestellt oder reduziert. Dazu zählen etwa Einsparungen im Baubereich sowie Ansätze, die nur bei zusätzlicher Förderung hätten umgesetzt werden können. Auch beim Doppeljubiläum wurden geringere Mittel als ursprünglich vorgesehen verwendet, sodass hierdurch weitere Mittel freigesetzt werden.
Im Finanzhaushalt werden unter anderem der geplante Geh- und Radweg entlang der Lieberoser Straße sowie der Bau von zusätzlichen Löschwasserentnahmestellen nicht realisiert. Der Neubau der Kita "Am Eichengrund" wird solange nicht begonnen, bis eine angepasste Kita-Bedarfsplanung vorliegt. Dann wird neu diskutiert.
Die Haushaltssperre wirkt somit unmittelbar auf die Umsetzung freiwilliger Leistungen und geplanter Investitionen und bleibt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Kraft. Pflichtige Aufgaben der Stadt und die Sicherung der laufenden Handlungsfähigkeit sind davon nicht betroffen.
Wie geht es für Lübben weiter? Auf welche Maßnahmen müssen sich die Bürgerinnen und Bürger einstellen?
Unsere Stadt steht vor der Aufgabe, Ausgaben zu begrenzen und gleichzeitig die finanziellen Grundlagen für die Zukunft zu sichern. Mir ist bewusst, dass viele Bürgerinnen und Bürger bereits an unterschiedlichen Stellen Belastungen spüren.
Zum einen überprüfen wir alle Ausgaben und setzen auf Einsparungen dort, wo sie die Bürgerinnen und Bürger nicht direkt treffen. Dazu gehören bereits die letzten Jahre ein effizienteres Gebäudemanagement, niedrigere Energie- und Betriebskosten sowie eine engere Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen. Auch die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen wird uns helfen, langfristig Kosten zu senken.
Zum Anderen müssen wir unsere Einnahmen erhöhen. Anstatt sofort Steuern zu erhöhen, wollen wir unsere eigenen Ressourcen besser nutzen. Wir vermarkten städtische Flächen gezielt, setzen auf Pacht- statt Verkaufslösungen und fördern Zwischennutzungen von Leerständen. Wir wollen außerdem Fördermittel von Bund, Land und EU noch stärker ausschöpfen. Kultur- und Tourismusangebote werden geprüft und effektiv vermarktet, um unsere Stadt auch für Gäste, Unternehmen und Investitionen zu attraktivieren. Zudem müssen wir an der einen oder anderen Stelle unsere Satzungen wohlüberlegt überarbeiten und Kosten neu kalkulieren – das ist längst überfällig.
Gleichzeitig investieren wir dort, wo es uns langfristig Kosten erspart: in Prävention, Bildung und in die Belebung unserer Innenstadt. Denn eine starke lokale Wirtschaft bringt uns dauerhaft höhere Einnahmen, etwa durch Gewerbesteuern. Auch nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien schaffen neue Chancen für unsere Stadt.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, unser Ziel ist klar: Wir wollen solide Finanzen, ohne dass die Last einseitig auf Ihren Schultern liegt. Wir setzen auf kluge Einsparungen, neue Ideen und nachhaltige Investitionen. So sichern wir die Handlungsfähigkeit unserer Stadt – heute und in Zukunft. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
FAQ | KURZ ERKLÄRT
WIE FINANZIERT SICH EINE STADT WIE LÜBBEN?
Um die Aufgaben erfüllen zu können, benötigt eine Kommune Geld. Dafür können eigene Steuern erhoben werden z. B. Grundsteuer, Hundesteuer, Gewerbesteuer. Zudem erhält die Stadt einen Anteil der Einkommensteuer und von der Umsatzsteuer. Für besondere Aufgaben, zum Beispiel für die Schulen und Kindergärten, erhalten die Gemeinden noch Extrageld. Dazu sagt man auch Schlüsselzuweisungen. Die Kommunen nehmen weiterhin öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ein. Diese werden auf der Grundlage von Satzungen bspw. als Gebühren für Kindertagesstätten, die Straßenreinigung, den Winterdienst und die Friedhöfe vereinnahmt.
FINANZHAUSHALT VS. ERGEBNISHAUSHALT – WAS IST DER UNTERSCHIED?
In einer Kommune wie Lübben gibt es zwei wichtige Teile des Haushalts: den Finanzhaushalt und den Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt zeigt, welche Erträge (z. B. Steuern, Gebühren) und Aufwendungen (z. B. Gehälter, Betriebskosten) die Stadt in einem Jahr erwartet. Es geht hier also darum, ob die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben decken. Das Ziel ist, am Jahresende ein möglichst ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, um finanziell stabil zu bleiben.
Im Finanzhaushalt geht es um die tatsächlichen Geldflüsse – also darum, wie viel Geld die Stadt einnimmt und ausgibt. Dazu gehören auch Investitionen in Gebäude, Straßen oder digitale Infrastruktur, aber auch die Rückzahlung von Krediten. Der Finanzhaushalt zeigt, wie viel Geld die Stadt tatsächlich zur Verfügung hat, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Zusammengefasst: Der Ergebnishaushalt bildet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt ab, während der Finanzhaushalt zeigt, wie viel Geld tatsächlich in der Kasse ist. Beide müssen zusammenpassen, damit die Stadt langfristig handlungsfähig bleibt.
WAS SIND PFLICHT- & FREIWILLIGE AUFGABEN?
Kommunalen Aufgaben unterscheiden sich in Pflichtaufgaben nach Weisung (vom Staat vorgegeben) und Selbstverwaltungsaufgaben. Letzte unterteilen sich noch mal in Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (§ 2 BbgKVerf). Pflichtaufgaben sind vom Gesetz festgelegte Aufgaben z. B. Melde- und Passwesen, Straßen und Fußwege. Freiwillige Aufgaben in Art, Umfang und Höhe bestimmt die Gemeinde selbst. Dazu zählen zumeist kulturelle Einrichtungen, der Betrieb von Sportstätten u. s. w.
WAS BEDEUTET EINE HAUSHALTSSPERRE?
Eine haushaltswirtschaftliche Sperre oder kurz Haushaltssperre wird von der Verwaltung erlassen, wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen so stark von der Planung abweicht, dass ohne die Sperre der Haushaltsausgleich gefährdet erscheint. Sie erfolgt im Verlauf des Haushaltsjahres als Reaktion auf eine unerwartete Notlage. Die „Haushaltswirtschaftliche Sperre“ ist in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg geregelt.
Dieses Haushaltsinstrument kann unterschiedlich scharf ausgestaltet werden. Es kann sich auf den Gesamthaushalt oder auf bestimmte Teile des Haushaltes beziehen. Ausgenommen hiervon sind vertragliche Verpflichtungen und unabweisbare Ausgaben.